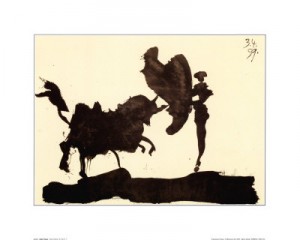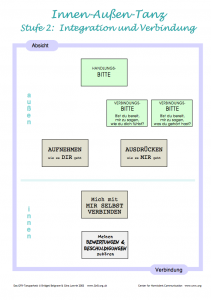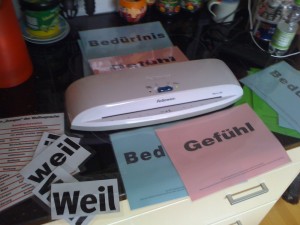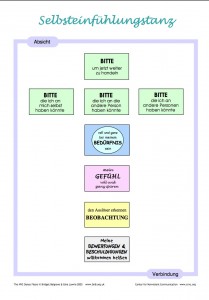Hallo, Welt!
Wieder mal gibt es ein ganzes Konglomerat an Themen und Gedanken in meinem Kopf. Da die Zeit fehlt, 20 Postings zu schreiben, hier ein neues “Kraut und Rüben“.
Dankbarkeit
Das ist noch immer ein Wahnsinns-Thema für mich.
Vorgestern habe ich bei meinem Nachbarn ein Paket abgeholt, das er für mich entgegen genommen hat. *D*A*N*K*E*
Für mich ist es so schwierig, nur am Samstag zur Post zu kommen, da hilft es ungemein, wenn jemand eine Sendung für mich annimmt.
Zu meinem Erstaunen war es ein neuer Lucky Kitty-Katzenbrunnen.
ich hatte das Gerät meinen Kindern zu Weihnachten geschenkt, aber ihre Katzen fanden es nicht attraktiv.
Meine schon, und so sprudelte seit Mitte Januar der Brunnen im Bad vor sich hin.
Seit vier Wochen leider auch drumherum. Ich fand nicht heraus, was damit nicht stimmte. Irgendetwas war undicht oder kaputt, aber was? Ein Riss oder eine Beschädigung war nicht zu erkennen. Ina schraubte vorige Woche dran rum, aber als es am nächsten Tag noch immer nicht funktionierte, verpackte sie für mich den ganzen Sch… in den Original-Karton und schleppte es zur Post. *D*A*N*K*E*
Anscheinend schon am Mittwoch war der neue Katzenbrunnen da, kommentarlos. Zack, Label drauf und an meine Adresse geschickt! *D*A*N*K*E*
Beim Auspacken und Installieren stellte ich eben fest, dass es sich um das Nachfolger-Modell handelt. Der untere Teil hat noch einen Ring aus Gummi, den mein erster Brunnen nicht hatte. Und es gab aufklebbare Gummifüße für drunter. *D*A*N*K*E*
Und so sitzen meine Vier wieder vor ihren Wasserspielen und freuen sich dran. Wie wunderbar!
Und dann hatte ich GfK-Besuch.
An zwei aufeinanderfolgenden Tagen waren zwei Frauen bei mir, mit denen ich wunderbare und bereichernde Gespräche führen durfte. Ich habe viel Neues über mich lernen dürfen und kam Kontakt mit dem Glaubenssatz „Du bist nicht gut genug“, der mich schon viele Jahre verfolgt. Ich schätze mal, das wird ein Thema für eine Arbeit mit „The Work“ von Byron Katie. Ich bin so froh, dass ich das erkennen durfte! *D*A*N*K*E*
Ergebnisoffene Empathie
Ich habe außerdem gelernt, warum es mir so kostbar ist, dass Empathie ergebnisoffen gegeben wird und nicht etwa mit einer klaren Bitte endet. Mir ist klar geworden, dass das etwas mit Kontrolle zu tun hat, für MICH.
Hintergrund: In der Übungsgruppe sagte jemand, er versuche Empathie nach den vier Schritten zu geben, und am Ende solle eine klare Bitte stehen. Mir war sehr unbehaglich dabei, ich konnte es aber nicht benennen. Dank der Gepräche mit meinen GfK-Freundinnen wurde mir deutlich, dass es mir besonders gar nicht immer um ein spezielles Ergebnis, eine Bitte, eine Handlungsoption geht. Manchmal tut es einfach gut, gesehen und gehört zu werden, und es muss gar nichts weiter dabei rauskommen… Und falls mich jemand im Empathieprozess da hin führen möchte, dass ein Ergebnis dabei rauskommt, dann ist das seins, aber nicht meins. Und dabei soll Empathie doch für mich sein, und nicht eine Leistungskontrolle für den anderen…
Frage: Ist das verständlich?
Liebe
Ich bin außerdem noch einmal mit der Liebe in mir in Verbindung gekommen. Das fühlte sich sehr schön an und ich bin so froh, dass ich das spüren durfte. Einfach so Liebe. Für einen anderen Menschen, dafür, dass wir alle immer das Beste tun, was uns möglich ist. *D*A*N*K*E*
Gäfgen II
Dann habe ich versucht zu verstehen, warum viele Menschen über das Gäfgen-Urteil so entsetzt sind. Welche Bedürfnisse sind bei ihnen unerfüllt? Strafe und Rache sind zum Glück keine Bedürfnisse. Aber vielleicht stört es die Menschen in ihrem Bedürfnis nach Ausgleich. Wer jemand anderem das Leben genommen hat, sollte für seinen eigenen Schaden keinen Ausgleich bekommen. Vielleicht hat es war mit Integrität und Kongruenz zu tun. Mit Sicherheit auch mit dem Bedürfnis nach Verstehen. Wie kann jemand Geld fordern, nachdem er so eine Tat begangen hat? Ich glaube, viele von uns denken, Herr Gäfgen sollte sich was schämen. Und das hat bestimmt etwas mit dem Bedürfnis nach Gleichwertikeit/Ausgleich/Gerechtigkeit zu tun, wobei Gerechtigkeit ja auch nur ein Konstrukt unserer kulturellen Identität ist.
Norwegen
Und ich ärgere mich über Innenminister Friedrich, über den im Spiegel steht:
Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) hat anlässlich der Anschläge in Norwegen ein Ende der Anonymität im Internet gefordert. „Politisch motivierte Täter wie Breivik finden heute vor allem im Internet jede Menge radikalisierter, undifferenzierter Thesen, sie können sich dort von Blog zu Blog hangeln und bewegen sich nur noch in dieser geistigen Sauce“, sagte Friedrich dem SPIEGEL. „Warum müssen ,Fjordman‘ und andere anonyme Blogger ihre wahre Identität nicht offenbaren?“
Die Grundsätze der Rechtsordnung „müssen auch im Netz gelten“, Blogger sollten „mit offenem Visier“ argumentieren.
Das Internet führt nach Ansicht Hans-Peter Friedrichs zu einer neuen Form radikalisierter Einzeltäter, die den Sicherheitsbehörden zunehmend Sorgen bereiteten. „Wir haben immer mehr Menschen, die sich von ihrer sozialen Umgebung isolieren und allein in eine Welt im Netz eintauchen“, so Friedrich. „Dort verändern sie sich, meist ohne dass es jemand bemerkt. Darin liegt eine große Gefahr, auch in Deutschland.“
Das erfüllt nicht mein Bedürfnis nach Schutz, Sicherheit, Freiheit und Ehrlichkeit. Die Norweger reagieren auf den Anschlag in ihrem Land mit Liebe:
Kronprinz Haakon sagte:
„Wir wollen Grausamkeit mit Nähe beantworten. Wir wollen Hass mit Zusammenhalt beantworten. Wir wollen zeigen, wozu wir stehen. Norwegen ist ein Land in Trauer. Wir denken an alle, die Verluste erlitten haben. Die vermissen.“
Haakon weiter: „Wir können das Geschehene nicht ungeschehen machen. Aber wir können uns entscheiden, was es mit uns als Gesellschaft und als Einzelne macht. Wir können uns dafür entscheiden, dass niemand allein stehen muss. Wir können uns dafür entscheiden, zusammenzustehen.“
„Wir wollen ein Norwegen, in dem wir zusammenleben in einer Gemeinschaft mit der Freiheit, Meinungen zu haben und uns zu äußern. In der wir Unterschiede als Möglichkeiten sehen. In der Freiheit stärker ist als Angst.“
Das ist die Welt, in der ich leben möchte. Und dazu möchte ich einen Beitrag leisten.
Hier noch eine wunderbare Zeichnung, die mich gestern über Gerhard Rothhaupt erreichte. Die Frage stellt sich zur Zeit nicht, aber ist schon sensationell… 
Da lohnt sich ein ausführlicher Blick auf die Bedürfnisliste, oder?
So long!
Ysabelle