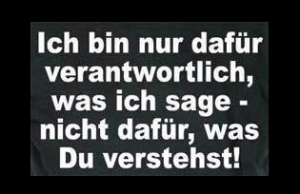Do nothing-Zeit
Hallo, Welt!
Am Samstag war ich als Assistentin bei einem GfK-Workshop, bei dem ein Lehrer von den Problemen mit einem Schüler erzählte. Am Ende einer Übung mit dem Tanzparkett fand er für sich heraus, dass er den betreffenden Jungen beim nächsten Eintreten einer vergleichbaren Situation bitten will, die Klasse zu verlassen und in einem anderen Raum zu warten, bis der Unterricht vorbei ist. Ich war ganz elektrisiert, denn es erinnerte mich an eine Erzählung von Marshall, der berichtete, wie einst an einer GfK-Schule ein Do-Nothing-Room eingerichtet wurde. Dorthin konnten Schüler gehen, die nicht am Unterricht teilnehmen wollten. Es war keine Strafe, sondern einfach ein Ort innerhalb der Schule, wo Nichtstun total in Ordnung war und auch die anderen nicht beim Lernen störte.
Gestern habe ich eine halbe Stunde vor dem Fernseher gesessen und nichts getan.
Und danach habe ich festgestellt, dass ich fast nie Do-nothing-Zeit habe. Mein Leben rauscht in einem Tempo, das keine Zeit für „Do nothing“, für Nichtstun lässt.
Nichtstun – das klingt in meinen Ohren wie Nichtsnutz. Wir haben so schöne Formulierungen wie Faulpelz, auf der faulen Haut liegen, faule Socke. Etwas fault, wenn es nur irgendwo rumliegt. Es setzt also Schimmel an. Es taugt nichts. Die Italiener sagen, Dolce far niente, süßes Nichtstun. in Deutsch ist Müßiggang aller Laster Anfang.
Nietzsche schrieb dazu:
„Die Arbeit bekommt immer mehr alles gute Gewissen auf ihre Seite: Der Hang zur Freude nennt sich bereits „Bedürfniss der Erholung“ und fängt an, sich vor sich selber zu schämen. „Man ist es seiner Gesundheit schuldig“ — so redet man, wenn man auf einer Landpartie ertappt wird. Ja, es könnte bald so weit kommen, dass man einem Hange zur vita contemplativa (das heisst zum Spazierengehen mit Gedanken und Freunden) nicht ohne Selbstverachtung und schlechtes Gewissen nachgäbe.“
Bestimmt hat mein Verhalten etwas mit meinen inneren Antreibern zu tun. Sie heißen
1. Sei perfekt
2. Beeil dich
3. Streng dich an
4. Mach es allen recht
5. Sei stark
und ein Test hat mal ergeben, dass mich alle fünf Antreiber ziemlich heftig im Würgegriff haben.
Ich gestehe es mir nicht zu, do-nothing-Zeit zu haben. Es ist doch immer was zu tun. Katzenklos, Bügelwäsche, endlich die Bilder in den Blog re-importieren, einen Rückruf, einen Brief beantworten… sei perfekt, machs allen recht…
In mir ist heute Abend ein großes Bedauern, dass ich so wenig Do-nothing-Zeit für mich finde. Ich kann sehen, welche wundervollen Bedürfnisse ich mir mit meinem vielfältigen Beschäftigungen erfülle. Und immer stärker wird in mir der Wunsch, einen Sabbat zu haben, einen Ruhetag, an dem ich nicht einmal das Licht selbst anmachen muss.
Am kommenden Wochenende schenke ich mir selbst einen reinen Do-Nothing-Tag.
Beschlossen und verkündet.
So long!
Ysabelle